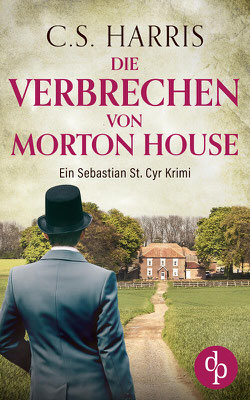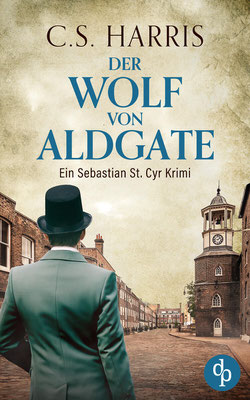Emilia und das Flüstern von Liebe
Roman

Eine verträumte Protagonistin wie in "Die fabelhafte Welt der Amelie", eine umwälzende Veränderung der Lebensumstände, ein Traummann, der in Wahrheit gar keiner ist. "Emilia und das Flüstern von Liebe" ist ein Roman der leisen Töne und der tief ausgeloteten Emotionen.
Theatersouffleuse Emilia Canotti lebt am liebsten unbemerkt. Deshalb liebt sie ihre Arbeit, die es ihr erlaubt, sich vor der Welt im Souffleurkasten zu verstecken. So kommt es, dass nicht einmal die Schauspieler sie kennen, deren professionelle Stütze sie doch ist. Doch dann dreht sich Emilias Leben plötzlich auf den Kopf. Sie muss aus ihrer gewohnten Umgebung heraus, als das für ein Eigenheim gehaltene Haus vom Vermieter gekündigt wird und ihre Mutter in eine Seniorenresidenz zieht. Von heute auf morgen soll Emilia ihr Leben allein in den Griff bekommen. In dieser unsicheren Lebenssituation ist sie ausgerechnet auf die Hilfe des Schauspielers Antoine angewiesen, von dem doch alle im Theater wissen, dass er ein skrupelloser Frauenheld ist, und den Emilia verachtet. Dabei verkörpert er auf der Bühne das Idealbild eines Mannes. Bald fragt sie sich, wo er mehr schauspielert - im Theater oder im realen Leben?
Beziehungsroman, Theaterroman
Leserstimmen:
Ein Roman der leisen Töne und der tief ausgeloteten Emotionen
Ein Buch aus einem Guss
Danke für dieses wundervolle Buch, das meine Seele berührt!
E-book €5,99, Taschenbuch (398 S.) €12,99 jetzt kaufen:
Überall im Online-Buchhandel
Lauriel liest:
Artikel zur Premiere in der SZ
XXL-Leseprobe

Emilia und das Flüstern von Liebe
von Angelika Lauriel
Kapitel 1
Schon eine ganze Weile beobachtete die Bäckereifachverkäuferin die Kundin, die in der Abteilung nebenan die Artikel untersuchte. Zuerst hatte sie sie nur im Augenwinkel wahrgenommen, was dann allerdings dazu führte, dass sie den Kopf drehte, um das bunte Wesen zu mustern, das von den Büchern zu den Schreibwaren gewackelt war. Der Anblick ließ sie nicht mehr los; verträumt lächelte sie. Der Duft der puderzuckerbestäubten Krapfen, die sie eben in die Theke gelegt hatte, bildete die ideale Ergänzung zu dem Schauspiel, das sie, da sich wenig Kundschaft im Kaufhaus aufhielt, aufmerksam verfolgte.
Das bunte Wesen entpuppte sich als eine nicht ganz schlanke Frau vielleicht um die vierzig, die sich auf unnachahmliche Art bewegte. Das war es auch, was die Aufmerksamkeit der Verkäuferin geweckt hatte: Jedes Mal, wenn sie den rechten Fuß aufsetzte, schwankte sie nach rechts und dann wieder zurück, wie ein Pinguin. Dadurch wirkte sie auf den ersten Blick älter, und die Zusammenstellung ihrer Kleidung unterstrich das noch. Sie trug einen runden lila Hut mit hochgeklappter Krempe, den sie tief in die Stirn gezogen hatte. Darunter baumelte ein dicker, brauner Zopf fast bis auf ihre Hüften hinab. Im Lilaton des Huts hatte sie offensichtlich in mühseliger Handarbeit ihren knallgrünen Einkaufstrolley mit großen Blumen bestickt, den sie bei jedem Schritt hinter sich herzog und dann direkt neben sich abstellte. Es wäre einfacher gewesen, den Trolley an den Kopfenden der Regale stehen zu lassen, doch nein, sie zog ihn jedes Mal mit sich und stellte ihn ab, als ob sie befürchtete, dass böse Buben ihn sich schnappen und damit fliehen könnten. Passend zu dem Hut trug die Frau einen langen, weiten Rock in Tannengrün, der mit riesigen, bunten Filzblumen besetzt war. ›Ob sie die selbst gefilzt hat?‹, dachte die Verkäuferin.
»Dit frag ick mir ooch immer«, erklang plötzlich eine Stimme neben ihr, und erschrocken blickte sie über die Theke in das Gesicht des alten Schubert, der eine Straßenecke weiter im Kleinen Theater als Hausmeister arbeitete.
Verlegen lächelte sie. »Habe ich etwa laut gedacht? Kennen Sie die Frau?«
»Ja, und Sie würden sie auch kennen, wennse schon wat länger hier arbeiten würden.« Er schob seine blaue Hausmeistermütze aus der Stirn und winkte ab. »Aber die Emilia, die macht sich eh nichts draus, wenn man sie nich kennt. Im Theater isse n unbeschriebenes Blatt, obwohl sie wirklich die Seele von dem Laden is, meiner Treu.«
Beide wandten ihre Aufmerksamkeit wieder Emilia zu. Die Verkäuferin lächelte beim Anblick der langen Häkelweste und der roséfarbenen Bluse mit Kordeldurchzug am Ausschnitt. Aus welchem Jahr sie ihre Modeanregungen wohl nahm?
»Ach, die scheint ja nach wat janz Bestimmtem zu suchen. Wat hält se denn da in der Hand?«
»Vorhin hat sie sich die Füller und Minenschreiber angeschaut, und jetzt ist sie bei den Kalendern und Notizbüchern gelandet. Sehen Sie nur, wie sie das Büchlein streichelt …« Die Verkäuferin unterbrach sich. Stand sie hier und tratschte mit einem Kunden über eine Kundin? Das ging ja gar nicht.
Doch Schubert nickte mit einem gutmütigen Lächeln. »Ja, sie fühlt, wie sie in der Hand liegen. Mir macht dit einfach Spaß, dem Mädchen zuzuschauen.« Er beugte sich zur Theke vor. »Wissense, die hat wat Besonderes, dit sieht man nich auf den ersten Blick. Ihr Vater muss dit schon jeahnt haben, sonst hätte er ihr nich diesen Namen jejeben. Emilia, und dit bei dem Nachnamen, wissense?
»Wie heißt sie denn mit Nachnamen?«
»Canotti. Na, klingelt was?«
»Emilia Canotti? Ne, da klingelt nichts.«
Schubert lachte. »Vielleicht sindse noch zu jung. Ihr junges Volk lest sowas heute nich mehr in der Schule, wa? Emilia Galotti is’n berühmtes Theaterstück vom ollen Gotthold Ephraim Lessing. Ah, ich sehe, den Namen habense schon jehört.« Der Hausmeister drehte sich erneut zu Emilia um, die soeben ein Buch ins Regal zurückstellte und nach einem mit Seide eingeschlagenen Büchlein griff. Ihr Gesicht strahlte auf, als sie die Hand darüber gleiten ließ.
Eifrig nickte die Verkäuferin in Schuberts Richtung. »Jetzt hat sie eines gefunden, das wird sie nehmen, was glauben Sie?«
»Ja, dit is so sicher wie dit Amen in der Kirche. Sehnse, jetzt jeht se zur Kasse. Emilias Vater war der große Canotti, toller Schauspieler. Der hat unserem Kleinen Theater zu Ruhm und Ehre verholfen, wirklich, dit hat er.«
Die Verkäuferin bedauerte es fast, als Emilia aus ihrem Blickfeld entschwunden war. »Was darf’s denn sein, Herr Schubert?«
»Gebense mir mal einen von den Krapfen da und dann noch ein kleines Vollkornbrot.«
Sie packte ihm das Gewünschte ein und reichte es über die Theke. »Und was ist jetzt das Besondere an Emilia Canotti?«
»Ihre Stimme.«
»Ihre Stimme?« Sie hatte erwartet, dass er sich über ihren Kleidungsstil auslassen würde oder über ihre Art zu gehen.
»Wissense, die ist Souffleuse. Aber was für eine! Meiner Treu, die hat schon manch einen von den großen Stars aus bösen Texthängern gerettet. Ja, sie hat eben diese besondere Stimme, wissense? Nich laut, gar nich laut. Aber die trägt, wennse verstehn, wat ick meine.«
Sie nickte zögernd. »Ja, ich glaube, ich kann es mir vorstellen. Man hört sie, auch wenn sie leise spricht.«
Er zeigte mit dem Finger auf sie. »Genau, Sie habens auf Anhieb erfasst. Und eines kann ich Ihnen sagen: Die Emilia beherrscht alle Rollen. Aus dem Effeff.«
Er verstaute die beiden Bäckertüten in seiner abgewetzten Umhängetasche und schloss sie umständlich. Dann hob er die Hand grüßend zur Mütze. »Ich will dann mal. Schönen Tach noch.«
»Bis morgen, Herr Schubert.«
***
Freitag, 15. April
Liebes Tagebuch
Geliebter Antoine
Mein lieber Antoine
Geliebter Antoine!
Jetzt lasse ich es so stehen – Geliebter Antoine!
An Dich wende ich mich. Du bist für mich da, wann immer ich Dich brauche.
Ich bin verwirrt. Was ist nur geschehen? Ich muß von vorne anfangen, mich erinnern, wie es früher war.
Meine Mutter hat mir das Tagebuchschreiben verboten – damals, als sie bemerkte, daß ich es noch immer tat, obwohl ich längst eine erwachsene Frau war. Mein Vater war gerade gestorben, wir mußten zurechtkommen. Sie mußte doch wissen, wie sehr ich litt. Trotzdem hat sie mir das Tagebuch vergällt. »Emilia, du bist zu alt, schämst du dich nicht? Sieh dich doch an! Weißt du, wie du mir vorkommst? Wie ein Kind, ja, wie ein Kind!«
Ob sie ahnte, wie sehr sie mich verletzte?
Als ob ich nicht wüßte, daß andere mich wunderlich finden. Aber es interessiert mich nicht. Und Dich, mein Antoine, wird es nicht berühren, dafür sorge ich. Meine Eigenarten werden Dein Leben nicht beeinträchtigen. Unsere Beziehung wird nur auf dem Blatt leben – und in meinem Kopf. Natürlich.
Du bist der Prinz meiner Träume. Wie schön, daß ich Dich gefunden habe und bei Dir meine Sorgen abladen kann. Doch ich schweife ab. Zurück zu meiner Mutter. Sie ist nämlich der Grund, weshalb ich mir heute Morgen nach acht Jahren ein wunderschönes Notizbuch gekauft habe und dazu diesen wohlgeformten Stift, dessen Tinte weich und ohne Kleckser in das Papier fließt. Eine Freundin der Tintenlöscher war ich nie, also streiche ich einfach durch, wenn ich mich mal verschreibe, mit einem einzelnen, sauberen Strich, ganz gerade, so ist es gut.
Zurück zu Mutter. Sie hat mich damals dazu gebracht, meine Sorgen nicht mehr aufzuschreiben. Vielleicht hatte sie ja recht. Mein Leben verschlimmerte sich nicht weiter, als mir diese Zuflucht verloren ging.
Aber jetzt … Ich bin völlig verwirrt. Was verlangt sie von mir? Nun wohnen wir mein ganzes Leben in diesem Haus, und plötzlich soll alles zu Ende sein?
Ach, sie ruft nach mir, ich muß fort. Antoine, ich werde Dir alles erzählen, alles.
Hier bin ich wieder, Geliebter.
Die Mutter brauchte mich, weil ich ihr helfen mußte, eine sperrige Leinwand von der Staffelei zu heben. Ich habe nicht viel mit ihr gesprochen, weil ich Dir doch alles erzählen will, loswerden muß, was mich so bestürzt. Ich weiß nicht, wie ich damit sonst zurechtkommen soll. Nun also zurück zum Anfang der ganzen Geschichte.
Meine Mutter Luise Canotti.
Gestern Morgen rief sie mich zu sich. »Emilia, setz dich mal hierher, ich habe mit dir zu reden.« Ich ahnte sofort, daß da etwas nicht stimmte, und schob mich mißtrauisch auf die Eckbank. Mit leisem Schrecken bemerkte ich, daß sie mir sogar meinen Lieblingstee aufgebrüht hatte.
»Exakt zweieinhalb Minuten, keine Sekunde länger. Dazu einen Zentimeter Zimtrinde und ein Stückchen Ingwer, so wie du ihn magst.«
Ich nahm die Tasse in beide Hände – sie spendete mir Wärme – und trank den ersten, köstlichsten Schluck von allen. Nein, das stimmt nicht, es ist nicht der köstlichste Schluck von allen. Nach einiger Zeit, wenn der süße Zimtgeschmack und die intensive Schärfe des Ingwers durchkommen, ist der Tee noch genauso delikat, nur anders.
»Was ist denn los, Mutter?«
Sie legte mir die Hand auf den Arm, ich starrte auf ihre trockene Haut, die einst wie ein Pfirsich strahlte, doch jetzt pergamenten wirkt, braun gesprenkelt und durchzogen von blauen Adern. Ihre Hände sind noch immer schlank, die Fingergelenke kaum durch Gicht verdickt. Ich lächelte: Die üblichen Farbkleckse bildeten diesmal ein lustiges Muster, fast wie eine Blume.
»Ich ziehe aus.«
Da stand der Satz im Raum. Obwohl sie in ganz normaler Lautstärke gesprochen hatte, gellte er in meinen Ohren, schwoll an, wiederholte sich wie ein Echo, das die Berge hin und her werfen. Ich sah von ihr weg zur Wand, ließ das ziselierte Blumenmuster in meine Augen fließen, das ich liebe, seit ich fünfundzwanzig Jahre alt war, und das nur mehr zu erahnen ist.
Es funktionierte nicht.
Ich bekam ihren Satz nicht aus dem Kopf. Leise summte ich »La Le Lu« vor mich hin, um ihn zu übertönen. Sie klopfte mir mit ihrer kalten Krallenhand auf den Unterarm. Ich zog ihn zurück und bedeckte ihn mit dem Ärmel meiner Bluse, liebkoste eine Sekunde den weichen Baumwollstoff. Dann starrte ich ihr in die Augen, um zu verstehen, was sie von mir wollte.
»Emilia, hast du gehört, was ich gesagt habe? Ich ziehe aus. Und du wirst ebenfalls ausziehen.«
Ich antwortete ihr nicht, wiegte mich hin und her. Sie stand auf, setzte sich neben mich auf die Bank und legte die Arme um mich. Ich schmiegte mich an sie, wie früher, als ich ein kleines Kind war, wenn sie sich endlich erinnerte, daß ich ja auch noch da war, und sich zu mir in den Wagenfond setzte, wenn Papa uns nach Hause fuhr nach einer Vernissage oder nach einem seiner grandiosen Erfolge am Theater. Ich fühlte mich sofort wieder geborgen in ihren Armen. Sie roch nach ihrem Parfüm, Chanel No. 5. Eine ihrer Extravaganzen, von denen ich so gar nichts übernommen habe. Ich schloß die Augen und ließ den Duft in mich einströmen.
Ach, könnte ich doch für immer Kind bleiben.
Aber ich schweife ab. Ich muß mich erst warmschreiben, bin das einfach nicht mehr gewohnt. Du, lieber Antoine, wirst es mir verzeihen. Ich weiß, daß Du geduldig bist und mich verstehst. Ich spüre schon jetzt, daß ich mich richtig entschieden habe. Du wirst mir helfen, ja, das wirst Du.
»Herr Holz hat uns das Haus gekündigt.«
Ich schnappte nach Luft. Haus gekündigt? Unser Haus? Mutters Atelier, mein großes Zimmer, Vaters Arbeitszimmer und der ganze Rest – unser Haus eben. Wie konnte uns das irgendjemand kündigen?
»Wer ist Herr Holz?«
»Unser Vermieter, Dummerchen.« Sie schnalzte mit der Zunge und ließ mich los, ich fühlte mich plötzlich kalt.
»Vermieter?«, krächzte ich. »Aber das ist doch unser Haus! Deines und meines.«
»Nein, mein Kind, das ist es nicht.« Sie schüttelte den Kopf, stand auf und ging sehr aufrecht auf und ab. Man sieht Mutter die dreiundachtzig Jahre nicht an. Sie trägt immer noch Jeans und weite Pullis, die über einer Schulter herunterfallen. Ihre Haare hat sie jetzt grau nachwachsen lassen, aber selbst das sieht an ihr pompös aus. Sie sieht genauso aus, wie sie ist: eine auffallende, begabte und anerkannte Künstlerin. Seit Vaters Tod hat sie aufgehört, in Galerien auszustellen und Vernissagen zu veranstalten, aber ihr Name ist über die Grenzen des Landes bekannt, und noch immer kaufen Menschen ihre Bilder.
Nicht unser Haus!
Kurz, ich erfuhr, daß das Haus, das ich immer als Eigentum meiner kleinen Familie betrachtet habe, ganz und gar nicht unseres ist, sondern daß meine Eltern es angemietet haben, als ich noch nicht auf der Welt war. Unglaublich, nicht?
Mutter fragte mich vorwurfsvoll, wieso ich das nicht wußte – aber ist es meine Schuld? Hat sie in den bald vierzig Jahren, die ich zuerst mit ihr und Papa, jetzt nur noch mit ihr hier wohne, je mit mir darüber gesprochen? Nicht daß ich wüßte! Geldangelegenheiten regelt sie immer allein, auch die meinen. Das Geld, das ich verbrauche, gibt sie mir, zusammen mit den Einkaufslisten für den Kühlschrank und den Vorratskeller. Ich bin froh, daß ich mich damit nicht zu belasten brauche.
Ich bin meinen Eltern dankbar, daß ich mich immer schon zurückziehen durfte, sobald wir zu Hause waren. In mein Refugium – mein Zimmer, das wir vor zwanzig Jahren so eingerichtet haben, wie es jetzt ist. Ich liebe es, ich fühle mich hier wohl. Alles hat seinen festen Platz. Über dem Bett hängt das Regal mit den Monchhichi-Püppchen, in der Kommode neben dem alten Sekretär bewahre ich meine Sarah-Kay-Blöcke auf. In der Glasvitrine strahlen und funkeln meine Herzen aus Glas oder Porzellan, und an ganz besonderen Tagen kann ich meine wunderschöne Sammlung erweitern. Sogar die alte Tischnähmaschine haben wir in meinem Zimmer unterbringen können. Ich schweife schon wieder ab, ich merke es ja. Das muß daran liegen, daß Du mich noch nicht kennst, geliebter Antoine. Ich möchte Dir zeigen, wie ich lebe. Verzeih mir!
Die Mutter erklärte mir, daß der Vermieter schon vor Monaten Eigenbedarf angemeldet habe und daß sie es im Grunde nur richtig finde, daß wir das Haus für ihn räumen.
Eigenbedarf?
Ich solle mir eine hübsche kleine Wohnung suchen, und es werde mir dort sicher sehr gefallen.
Nein! Es wird mir nicht gefallen! Ich will nicht hier raus!
Ich hätte keine andere Wahl … Ich habe keine andere Wahl!
Sie strich sich über die graue Lockenmähne und setzte sich mir gegenüber, dann beugte sie sich vor, der Pullover rutschte runter und ließ ihre Schulter frei mit den braunen Flecken darauf. Ich betrachtete ihre Größe, Formen, unterschiedlichen Farbstufen. Wie sie diese Flecken haßt! Ich finde sie schön. Das Muster wirkt beruhigend. Ich versenkte mich ganz in den Anblick und ließ einfach alles abgleiten. Vielmehr, ich versuchte, es abgleiten zu lassen. Sie ließ mich nicht.
»Ich habe beschlossen, mit Hugo zusammenzuziehen. Wir haben eine wunderschöne Residenz für Senioren gefunden, in der ich sogar mein Atelier einrichten kann.«
Hugo?
Seniorenresidenz?
Nur aus großer Ferne drangen die Worte meiner Mutter zu mir durch, ich schaffte es beinahe, sie gar nicht zu hören. Beinahe.
Richtiger Zeitpunkt
Lebensgefährte
Künstler, wie sie
drei gemeinsame Zimmer
Finanzierung
Anwaltskanzlei …
Sie warf mit fremden Worten um sich.
Verstehst Du jetzt, Geliebter, daß ich völlig verwirrt bin? Ich konnte gestern nicht zum Theater, ich meldete mich beim alten Schubert krank. Du hattest ja kein Stück zu spielen. Und die anderen – ich weiß nicht, ob sie überhaupt bemerken, wenn mich jemand vertritt.
Die Nacht war grauenvoll. Ich wälzte mich hin und her. Alles Flehen meiner Mutter gegenüber hatte nichts genützt, sie war hart geblieben. Es wäre alles geklärt und sie werde das nicht mehr ändern. Niemand könne ihr mißgönnen, daß sie nochmal mit einem Mann glücklich werden wolle, und außerdem sei es an der Zeit, daß ich lerne, auf eigenen Füßen zu stehen.
Ich kam erst zur Ruhe, als es mir endlich gelang, Deinen Anblick vor meinen geschlossenen Augen zu sehen. Ich sah Dich als Prinzen im Weihnachtsmärchen des vorletzten Jahres, erinnerst Du Dich? Ich fühlte mich geborgen und beschützt.
Und heute?
Nichts ist besser geworden, nichts. Zum Glück gelang es mir, mich innerlich zurückzuziehen in mein Schneckenhäuschen. Ich spüre, wie sich eine neue Drehung obenauf windet, die meinen Schutz, meine Abschottung nach außen, noch weiter stärkt. Ich glaube, diese neue Windung wird oben so spitz zulaufen, daß niemand wagen wird, mich anzufassen, mein Haus anzufassen und mit neugierigen Fingern hineinzugrabschen und zu wühlen, um meinen weichen inneren Kern herauszuzerren. Ich grabe mich ein, ganz tief nach innen, dorthin, wo niemand mich findet.
Ach! Es nützte mir nichts. Die Mutter versuchte gar nicht erst, nach mir zu wühlen, sondern sie hockte sich vor mein Häuschen und wartete.
»Ich habe Schubert für dich angerufen und ihm gesagt, daß du morgen wieder kommst.« Sie blickte auf die Uhr an der Wand. »Es ist auch schon zu spät. Du hast den ganzen Tag verschlafen.«
Ich schob vorsichtig meinen Kopf vor und fuhr die Fühler aus. Obwohl ich es nicht wollte – es gefällt mir viel besser tief dort drinnen, wo es dunkel ist, warm, leise –, strebte ich ihr entgegen. Sie ergriff die Gelegenheit und streichelte mir über den Arm, dann half sie mir aus dem Bett hinaus und geleitete mich in die Küche. Ich verhedderte mich beinahe in meinem langen Nachthemd, als sie mich zur Eckbank schob. Sie öffnete behutsam meine Hand und drückte mir eine Tasse mit dampfendem Tee hinein. Ich verließ mein Häuschen. Sie ist meine Mutter, sie will mir nichts Böses.
»Ach, mein Kind«, seufzte sie. »Ich hätte es dir viel früher sagen müssen.« Sie legte wieder beide Arme um mich und streichelte dann über meine Haare, die sich in der Nacht aus dem Zopf gelöst hatten, sodaß ich irgendwann heute Morgen im Versuch, den Tag so zu beginnen, als wäre nichts geschehen, das Gummi herauszerrte. Dann fand ich jedoch nicht die Kraft, ihn neu zu flechten. Oder mich zu duschen, anzuziehen, eben all die Geschäfte zu erledigen, die Normalität bedeuten. Mein »La Le Lu« auf den Lippen, das tief in meinem kuscheligen Refugium klingt wie eine Melodie, die aus der Ferne heranweht, legte ich mich nach dem Frühstück wieder hin und versank erneut in tiefem, traumlosem Schlaf.
»Hab keine Angst.«
Ich hörte Mutters Stimme und schloß die Augen. Alles ist gut.
»Morgen wirst du wieder zur Arbeit gehen, mein Schatz.«
Kapitel 2
»Ah, wunderschönen guten Tag, Herr Berthé, oder soll ich ›Guten Abend‹ sagen?« Hausmeister Schubert nickte Antoine zu, während er selbst nicht mehr als ein Lächeln für ihn übrig hatte. »Heute spät dran, wa?« Der Alte öffnete das Schiebefenster seines Kabuffs und beugte sich ein Stück heraus, um ihm den Satz hinterherzurufen. Seine Stimme klang freundlich und aufmerksam, wie immer.
Antoine war bewusst, dass Schubert zum Inventar des Theaters gehörte wie die uralten Requisiten, die unter der Drehbühne aufbewahrt wurden. Er mochte den »Dinosaurier«, wie sie ihn in der Crew manchmal nannten. Er winkte ihm knapp zu.
»Na, ohne Sie werden die schon nich anfangen, wa?« Sein Lachen klang Antoine hinterher, als er die Treppe hinaufeilte und zur Garderobe mehr rannte als ging. Else – mit Künstlernamen Lulu – riss die Tür neben der seinen auf.
»Mist, wo bleibst du denn?«, fauchte sie. Er ließ seinen Blick für eine Sekunde auf ihrem Brustansatz ruhen, den das schwarze Mieder ihres Kostüms bestens in Szene setzte. Sie grinste. »Na, jetzt bist du ja da.« Sie trat in den Flur, schlang, seine Hand an der Türklinke ignorierend, beide Arme um ihn und spitzte die Lippen, um ihn zu küssen. Dabei achtete sie darauf, ihr Makeup nicht zu verschmieren. Er erwiderte ihren Kuss so, dass sie gleich darauf keinen Wert mehr auf ein perfektes Makeup legte, dann schob er sie behutsam von sich.
»Na, Käthchen, wieder ein bisschen überschwänglich? Wir stehen noch nicht auf der Bühne. Ich muss mich jetzt fertigmachen.«
Bevor sie antworten konnte, huschte er in die Männergarderobe. Ein Gemisch an Aromen empfing ihn. Das alte Holz der Dielen und der Waschtische, über denen die Spiegel angebracht waren, strömte einen intensiven Geruch nach Bohnerwachs aus, und die künstlichen Düfte der Schminken und der Deodorants der Darsteller übertönten nur mühsam den unterschwelligen Schweißgeruch. Alter Schweiß, der sich in schweren Samt- und Brokatstoffen festgesetzt hatte, zeugte von aufregenden Premieren, peinlichen Notsituationen auf der Bühne oder schlicht von Übelkeit erregender Angst. Frischer Schweiß, der Lampenfieber erahnen ließ, sickerte gerade erst in die Bühnenkleidung der Männer ein, die sich vor den Spiegeln oder Kleiderständern für ihren Auftritt fertig machten. Die meisten von ihnen waren längst umgezogen, nur wenige legten noch letzte Hand an. Den Gestank muffiger Socken ignorierend, eilte Antoine an dem überladenen Wäscheständer vorbei, auf dem schon erste Kostüme für das nächste Stück hingen, und eroberte einen freien Spiegel.
»Ah, da ist ja der Herr Superstar endlich. Na, Gott sei Dank! Was hätten wir sonst wohl getan? Pünktlichkeit hat der feine Herr natürlich nicht nötig.« Kurt, der den Waffenschmied Theobald Friedeborn mimte, runzelte die Stirn, brachte ihm dann jedoch das Kostüm des jungen Grafen vom Strahl.
»Nur keinen Neid.« Antoine nickte ihm dankend zu, schob das Gesicht vor und tuschte seine Wimpern.
»Hast du wieder ein Frauenherz brechen müssen, oder weshalb kreuzt du hier so verdammt spät auf?«
»Unsinn, wo denkst du hin?« Er zog die Hand von den Augen zurück und zuckte die Schultern. »Einfach verschlafen.«
»Den ganzen Tag?«
»Na ja, gestern Abend war es spät. Was willst du?«
»He, beeilt euch mal da hinten. In zehn Minuten geht es los, und wenn ich mich nicht sehr irre, seid ihr beide im ersten Aufzug auf der Bühne.« Lorenzo, der den abgelegten Verlobten der Gräfin Kunigunde spielte, warf ihnen einen Wattebausch zu, dem Antoine geschickt auswich. Er sprang auf, schlüpfte aus seiner Jeans und zog hastig die gräflichen Beinkleider und das Wams über.
Kurt fuhr ihm mit einem grobzinkigen Kamm durch die dichten Haare. »Wie du wieder aussiehst, Mann!« Er näherte sich Antoines Kopf. »Was sehe ich denn da?«, feixte er. »Ein graues Haar, und hier noch eines, und da und da!« Er wollte ihm in den Schopf hineinfassen, offensichtlich, um ein Haar auszureißen, doch Antoine ruckte mit dem Kopf zur Seite.
Kurt schnaubte. »Na, da wird es langsam zu Ende gehen mit den Rollen als jugendlicher Liebhaber.«
»Alle Akteure auf die Bühne«, klang eine Stimme aus dem Flur, und mit einem letzten Blick in den Spiegel eilte Antoine den anderen hinterher. Durch den Bühneneingang traten sie vor die Kulissen und verteilten sich. Antoine zupfte noch an seiner Kleidung herum und versäumte deshalb, wie sonst, einen prüfenden Blick auf die anderen, zum Teil vermummten Darsteller, das aufgebaute Höhlenszenario und den Souffleurkasten vorne zu werfen. Der Vorhang hob sich bereits, und ein paar vereinzelte Zuschauer klatschten zaghaft, hörten dann jedoch auf, als niemand in das Klatschen einfiel. Im Publikum wurde es still, und gespannte Erwartung schwappte wie eine Welle an den Bühnenrand. Sofort spürte Antoine den Pulsschlag des wahren Lebens.
Das Femegericht des ersten Aktes nahm seinen Lauf. Insbesondere Kurt hatte viel Text zu sprechen, schnell fand Antoine sich in die sperrige, altertümliche Sprache ein. Nach und nach nahm der Charakter, den er selbst spielen sollte, ihn in Besitz. Das reale Leben zog sich aus seinem Kopf zurück, und er identifizierte sich ganz mit dem jungen Grafen, der angeklagt wurde, Käthchen von Heilbronn mit einem Liebeszauber verhext zu haben. Als ihr Vater, der Waffenschmied, schwärmerisch ihre guten Eigenschaften aufzählte und sie mit einem leibhaftigen Engel verglich, erstand vor seinem inneren Auge Lulu, doch nur für eine Sekunde stieg in seiner Brust ein Kichern auf, dann nahm Lulu für ihn die Identität der Figur an, die sie spielte.
Nur als Hintergrundrauschen nahm Antoine die Stimme der Souffleuse wahr. Kurts Text war definitiv nicht einfach, doch er verhaspelte sich nicht ein einziges Mal.
Kurz vor seinem eigenen Einsatz huschte Antoines Blick aus alter Gewohnheit zum niedrigen Kasten vorne in der Bühne. Über ihr Textbuch gebeugt saß dort die Souffleuse. Man sah nur die obere Hälfte ihres Kopfes. Etwas stimmte nicht an diesem Anblick, doch schon sprach Kurt seinen letzten Satz.
»Graf Wetter vom Strahl«, rief Graf Otto, der Vorsitzende des Gerichts aus, »ist dies gegründet?« Sein Stichwort!
Antoine erhob die Stimme, routiniert, mit halbem Ohr auf die Einflüsterungen der Souffleuse lauschend – und stutzte. Da stimmte etwas nicht. Er flog aus der Rolle heraus, und als Antoine, nicht als Graf, sprach er: »Wahr ists, ihr Herren; sie geht auf der Spur, die hinter mir zurückbleibt. Wenn ich mich umsehe, erblick ich zwei Dinge: meinen Schatten und sie.«
Das Stück lief weiter, als sei nichts geschehen, wie ein Automat spulte er seinen Text ab, versuchte, sich die Identität des Ritters wieder überzustreifen, doch er verschmolz nicht mehr mit seiner Rolle. Ihm brach der kalte Schweiß aus. Es schien ihm, als runzelten alle Darsteller missbilligend die Stirn, als er seine langatmigen Monologe aufsagte – fehlerlos, aber ohne Leidenschaft. Selbst die Gesichter der Zuschauer ließen ihn nur allzu deutlich spüren, dass er sie nicht erreichte. Auch nach der Pause, in der er die Toilette aufsuchte, blieben sie distanziert, ihr Applaus fiel höflich aus, und anstatt vier oder fünf Vorhängen, wie sonst üblich, verlangten sie lediglich einen zweiten – und den auch nur mit viel gutem Willen.
Als sie sich zum letzten Mal verbeugten und der Vorhang endgültig fiel, drückte Lulu seine Hand etwas fester. »Was war los, du hast abwesend gewirkt?«
Er warf ihre Hand von sich, als habe sie ihn verbrannt, und registrierte nur nebenbei, dass die anderen sich nicht weiter um ihn kümmerten. Wieso machten sie ihm keinen Vorwurf, wo er doch das ganze Stück versaut hatte?
»Antoine? Was hast du?« Lulu hatte noch immer diesen unschuldigen Käthchenblick drauf. Sie wirkte wie die einfältige Heldin des Stücks, wie in Liebe entflammt – es ekelte ihn an. Er ahnte es bereits: Diese Beziehung würde auch nicht mehr lange halten. Eigentlich schade, wo sie wirklich eine attraktive Frau war. Sehr jung noch, in den Zwanzigern, sexy und ausdauernd, dabei als Schauspielerin durchaus begabt.
Doch viel mehr beschäftigte ihn eine andere Frage: Wo, zur Hölle, war die richtige Souffleuse heute Abend abgeblieben, diese … wie hieß sie doch gleich?
»Weißt du, wo die Einsagerin heute Abend war?«, fuhr er Lulu an, als sie beide zu den Garderoben gingen.
»Wieso? Die war doch da.«
Er schüttelte den Kopf. »Aber nicht die Richtige! Das muss eine Vertretung gewesen sein.«
Lulu zuckte die Schultern, öffnete die Tür zur Frauengarderobe und trat halb hinein. »Ist mir nicht aufgefallen. Sehen wir uns gleich noch?«
In ihm hatte sich die Übelkeit über sein missglücktes Spiel noch nicht gelegt. Er fühlte sich wie einer dieser ewiggescheiterten Stümper, die nur kleine Statistenrollen abbekamen, und an deren Namen niemand sich erinnerte. Sein Magen zog sich zusammen.
Scheiße! Als sie sich zum letzten Mal verbeugten und der Vorhang endgültig fiel, drückte Lulu seine Hand etwas fester. »Was war los, du hast abwesend gewirkt?«
Er warf ihre Hand von sich, als habe sie ihn verbrannt, und registrierte nur nebenbei, dass die anderen sich nicht weiter um ihn kümmerten. Wieso machten sie ihm keinen Vorwurf, wo er doch das ganze Stück versaut hatte?
»Antoine? Was hast du?« Lulu hatte noch immer diesen unschuldigen Käthchenblick drauf. Sie wirkte wie die einfältige Heldin des Stücks, wie in Liebe entflammt – es ekelte ihn an. Er ahnte es bereits: Diese Beziehung würde auch nicht mehr lange halten. Eigentlich schade, wo sie wirklich eine attraktive Frau war. Sehr jung noch, in den Zwanzigern, sexy und ausdauernd, dabei als Schauspielerin durchaus begabt.
Doch viel mehr beschäftigte ihn eine andere Frage: Wo, zur Hölle, war die richtige Souffleuse heute Abend abgeblieben, diese … wie hieß sie doch gleich?
»Weißt du, wo die Einsagerin heute Abend war?«, fuhr er Lulu an, als sie beide zu den Garderoben gingen.
»Wieso? Die war doch da.«
Er schüttelte den Kopf. »Aber nicht die Richtige! Das muss eine Vertretung gewesen sein.«
Lulu zuckte die Schultern, öffnete die Tür zur Frauengarderobe und trat halb hinein. »Ist mir nicht aufgefallen. Sehen wir uns gleich noch?«
In ihm hatte sich die Übelkeit über sein missglücktes Spiel noch nicht gelegt. Er fühlte sich wie einer dieser ewiggescheiterten Stümper, die nur kleine Statistenrollen abbekamen, und an deren Namen niemand sich erinnerte. Sein Magen zog sich zusammen.
»Nein«, blaffte er. »Heute nicht. Ich muss nach Hause.«
Ihre Augen füllten sich mit Tränen! Hatte man so etwas schon gesehen? Wie alt war sie, verdammt, und was erwartete sie von ihm?
»Aber ich dachte … Du hast doch gesagt …«
»Was!«
»Nichts … Ich bin davon ausgegangen, dass wir noch mit den anderen zusammen einen trinken gehen, und danach wolltest du mit zu mir kommen.«
Stimmt, das hatten sie vereinbart. Aber ihm war jetzt nicht danach. Normalerweise wäre alles ganz anders, aber so?
»Geht nicht, ich kann nicht. Jetzt stell dich halt nicht so an.«
»Schon gut, schon gut«, beschwichtigte sie ihn und streichelte mit zarten Fingern über seinen Unterarm. »Ein andermal?« Sie legte ein Flehen in ihren Blick, zusammen mit einem Versprechen, das ihn beinahe wanken ließ. Doch sein rebellierender Magen siegte über seinen Schwanz.
Er antwortete nicht mehr, lächelte ihr jedoch zu und betrat die Garderobe.
Kurt trug schon wieder Jeans und Karohemd und strahlte damit die Eleganz eines Kneipenwirts aus. Keiner würde in ihm den Schauspieler vermuten, der noch vor einer halben Stunde gestelzt und ausschweifend in der alten deutschen Sprache dahergeredet hatte – und zwar auf eine Art, die die Zuschauer exakt verstehen ließ, was er da faselte. Ja, wäre Kurt nicht so klein geraten und schöbe er nicht diesen unübersehbaren Ansatz einer Bierwampe vor sich her, hätte er es durchaus mit ihm selbst aufnehmen können. Aber so wurde er immer für die Rollen der älteren Herren besetzt. Antoine fragte sich, ob er überhaupt je eine der reizvollen jüngeren Rollen hatte spielen dürfen. Andererseits war es natürlich durchaus ein Höhepunkt eines jeden Theaterschauspielers, etwa in den Faust zu schlüpfen, und ihn hatte Kurt bereits vor zehn Jahren gespielt. Antoines Magen beruhigte sich bei diesem Gedanken – würde doch er selbst schon bald den Faust spielen, und er hatte die Absicht, ihn nicht nur zu spielen. Er würde Faust sein, mit allen Abgründen, die die Rolle mit sich brachte. Er würde Zweifel, Schrecken, Ekel in den Zuschauern hervorrufen.
WENN – ja, wenn die Bedingungen stimmten. Wieder schoss ihm ein heißer Strahl in den Magen.
»Sagt mal, weiß einer von euch, was mit der kleinen Souffleuse los ist, wie heißt sie doch gleich?«